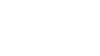Wo beginnt die Liebe? Was sind die Voraussetzungen für Liebesfähigkeit? Welche psychoanalytischen Konzepte gibt es in Bezug auf die Liebe? Und kann man Liebe eigentlich lernen? Das Thema birgt viele Fragen und der Tag brachte spannende Meinungen, Ansichten und einige Antworten.
Vom Wiederfinden der „besseren Hälfte“
Prof. Dr. med. Nestor D. Kapusta zeichnete in seinem Referat ein Bild über geschichtliche Konzepte der Liebe und betrachtete die Liebesfähigkeit aus psychoanalytischer Perspektive. In Anlehnung an Platons „Kugelmenschen“, die, von den Göttern getrennt, nach Wiedervereinigung streben, schuf Freud das Konzept der Libido als einen grundlegenden nach dem Liebesobjekt drängenden Trieb. Diese Suche nach der anderen, vielleicht besseren Hälfte, stellt ein Urmotiv des Menschen dar, das seine „kulturelle Ausprägung des Findens und sich Bindens“ in der Ehe habe. Freuds These war, dass jedes Finden eigentlich ein „Wiederfinden“ sei – bei ihm jedoch auf die Mutter bezogen: „Nicht ohne guten Grund ist das Saugen des Kindes an der Brust vorbildlich für jede Liebesbeziehung geworden“, zitierte der Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie aus Freuds Werk. Dieses Verlangen höre niemals auf. Sogar die äussert lustvolle Erfahrung einer körperlichen Verschmelzung im Sexualakt könne von dem Gefühl einer wiedergewonnenen Einheit mit der Mutter abgleitet sein.
Wen überrascht es da, dass Kränkungen und Verletzungen durch geliebte Menschen zu den grössten menschlichen Enttäuschungen zählen?
Was ist die Liebesfähigkeit?
Anhand der Objektbeziehungstheorie von Melanie Klein (1882-1960, österreichisch-britische Psychoanalytikerin), beschrieb Kapusta, welche Bedingungen nötig sind, damit die kindliche Psyche überhaupt Liebesfähigkeit entwickeln kann. Fehlt diese – etwa durch unaufgelöste belastende Erfahrungen vor alle in der sogenannten vorsprachlichen Zeit – so kann die psychoanalytische Behandlung zur Entwicklung und Pflege einer reiferen Liebesfähigkeit beitragen.
Für Kapusta ist es das wichtigste Ziel der Behandlung, Bedingungen herzustellen, die das Heranbilden einer reifen Liebesfähigkeit wieder möglich machen. Dabei bedeute Liebe nicht nur Befriedigung, sondern sich die Liebesfähigkeit zu erhalten, obwohl und gerade wenn die Befriedigung ausbleibe. Die Liebesfähigkeit offenbart sich dort, wo Ablehnung durch das geliebte Objekt Schmerz und Trauer mit sich bringt, aber nicht in der Lage ist, intensive Gefühle der Zuneigung und Liebe zu zerstören.
Download Vortrag Prof. Dr. med. Nestor D. Kapusta (PDF)
Liebesfähigkeit ja, Beziehungsfähigkeit nein!
Die Liebesfähigkeit ist jedoch kein Garant für eine reife Beziehung. Dies zeigte Professor Dr. phil. Inge Seiffke-Krenke in ihrem Referat. Sie befasste sich darin mit der verzögerten Identitätsentwicklung und einer Veränderung in den Partnerbeziehungen. So zeigen Studien, dass relativ viele Erwachsene bis 35 Jahre (15 Prozent) eher oberflächliche, wenn auch langdauernde Beziehungen führen. Immer häufiger gibt es unverbindliche Beziehungen und weniger symbiotische.
Die Identitätsentwicklung ist eine entscheidende Voraussetzung für eine reife Partnerbeziehung, die auch Intimität zulässt. Laut einer Metaanalyse aus 125 Studien, die Seiffke-Krenke in ihrem Referat anspricht, haben ca. 40 Prozent der heute 30-jährigen noch keine reife Identität erreicht. Folgende Tendenzen und potentielle Gefahren in Hinblick auf die Intimität und die verzögerte Identitätsentwicklung sind zu erkennen:
- Intimität und Mobilität passen nicht zusammen (Generation Praktikum, keine festen oder längeren Arbeitsverträge mehr).
- Veränderte Eltern-Kind-Beziehung: „The child on the podest“; das Kind wird zum „narzisstisches Selbstobjekt“, das der eigenen Aufwertung dient, wenn es von anderen bewundert oder gesehen wird. Dies kann zu zuviel Unterstützung und einem verzögerter Auszug aus dem Elternhaus führen.
- Social Media bringt virtuelle Freunde, man definiert sich nach dem Motto: „Ich werde gesehen, also bin ich.“ So geht die Tendenz von intimen hin zu oberflächlichen Beziehungen.
- Online Beziehungen mit eher seltenen Realkontakten erfordern eine teils exhibitionistische Selbstdarstellung und führen zu einer „Schein-Intimität“.
Andererseits, so Seiffke-Krenke, ist gerade der gefühlte Mangel an Intimität einer der häufigsten Gründe für die psychologische Paarberatung.
Download Vortrag Professor Dr. phil. Inge Seiffke-Krenke (PDF)
Raum und Zeit für die Liebe
Doch kann die Paartherapie die Liebe zurückbringen? Mit dieser Frage setzte sich Professor Dr. Marcel Schär in seinem Referat auseinander. Nach seiner Erfahrung gibt es während oder nach einer Paartherapie immer kleine Veränderungen, die jedoch schwer zu erkennen sind. Dies vor allem, weil die Partner häufig in alten Mustern festgefahren sind und dazu neigen, auch beim Partner die Wiederholungen der immer gleichen Fehler zu erwarten.
Merkmale einer tiefergehenden Liebe sind für Schär: Fürsorge, Verantwortung, Achtung und Erkenntnis. Diese Liebesfähigkeit zu entwickeln ist aber oftmals nicht so einfach, da es auf dem Weg dahin einige Verwicklungen und Verwirrungen gibt:
- Der eine Partner macht den anderen für seine Entwicklung, Gefühle und Leiden verantwortlich.
- Unstimmigkeiten in der Kommunikation: „Ich sage - aus Furcht zurück gewiesen zu werden - nicht, was ich eigentlich brauchen würde.“
- Aufgrund innerer Konflikte weiss der Betroffene nicht mehr, was er eigentlich will. Er ist hin und her gerissen zwischen Nähe und Distanz.
Schärs Empfehlung für Paare lautet daher: Dem gemeinsamen Glück von Anfang an genügend Raum und Zeit zu geben. Schär ist zudem davon überzeugt, dass eine verbesserte Kommunikation zwischen den Partnern die Liebe zurück bringen kann.
Kann man Liebe lernen?
Dass Vertrauen eine wichtige Basis für die Liebe ist machte Prof. Dr. phil. Elisabeth Schramm deutlich. Ohne Vertrauen keine Liebe. Dieses Vertrauen fehlt chronisch depressiven Menschen meistens. Grund dafür sind oft zwischenmenschliche Traumatisierungen, emotionale Vernachlässigung und emotionaler Missbrauch. Damit wird auch der Erwerb der Liebesfähigkeit erschwert. Frühere Beziehungstraumatisierungen gehen oft einher mit eingeschränkter Motivation, Probleme anzugehen und einer eingeschränkten Empathiefähigkeit. Zudem ist es für Patienten mit einer chronischen Depression schwierig, die eigenen Gefühle wahrzunehmen.
Schramm stellte einen für diese Patientengruppe besonders geeigneten verhaltenstherapeutisch-interpersonellen Ansatz vor (CBASP). Dabei ist zentral, dass der Therapeut oder die Therapeutin durch persönliche Einbringung (Disciplined Personal Involvment) eine emotionale Verbindung zum Patienten herstellen kann. Das auf diese Weise vermittelte ehrliche und unmittelbare Mitfühlen, die sogenannte „authentische Empathie“ ermöglicht es dem Erkrankten, in kleinen Schritten wieder Vertrauen zu einer Bezugsperson zu fassen, auch wenn für viele zu Beginn der frühe Vertrauensverlust fast nicht überbrückbar erscheint. Distanziert-passives oder teilweise passiv aggressives Verhalten kann reduziert, eine kooperative Mitarbeit in der Behandlung erzielt werden. Daraus wird deutlich, dass sich die Fähigkeit, Nähe, Vertrauen und Sicherheit in den Beziehungen herzustellen, erlernen lässt.
Download Vortrag Prof. Dr. phil. Elisabeth Schramm (PDF)
Der „Seiltanz“ zwischen Nähe und Distanz
Die Nähe, Intimität und emotionale Verbindung zwischen Therapeut und Patient kann also hilfreich sein, um die Liebesfähigkeit zu entwickeln. Doch wir kennen auch den Begriff der „Übertragungsliebe“; wenn der Patient in der Beziehung und im Gefühl zu seinem Therapeuten frühere Beziehungserfahrungen wiederholt. Diese Nähe kann Bindungs- und Sicherheitsgefühle wecken, die sich aber auch – ähnlich wie die kindliche Liebe – mit sogenannten Triebimpulsen mischen kann.
Dr. med. Stephan Schmidt beschrieb in seinem Vortrag den erforderlichen „Seiltanz“ zwischen Intimität und Abgrenzung in der Psychoanalyse. Eine anspruchsvolle Arbeit: Einerseits soll in der Therapie ein vertrauensbildender, liebevoller und intimer Denk-, Fühl- und Assoziationsraum geboten werden und der Therapeut als Mensch „authentisch empathisch“ auftreten, um Vertrauen und Sicherheit zu schaffen. Das kann im Patienten starke Gefühle für den Therapeuten auslösen, die beispielsweise den Gefühlen gegenüber Mutter oder Vater ähneln. Andererseits ist es Aufgabe des Behandelnden, sich klar gegenüber dem Patienten abzugrenzen, den „assoziativen Raum zu schützen und zu begrenzen.“ Dadurch kann sich der Patient jedoch an frühere Verletzungen bzw. Zurückweisungen erinnert und erneut zurückgewiesen fühlen.
Schmidt legte den Fokus auf den sorgsamen und konstruktiven Umgang mit der sogenannten Übertragungsliebe und forderte Psychotherapeuten auf, „genau hinzuhören, aber gleichzeitig auch sich selber genau zuzuschauen, auf was sie im Fluss der Erzählung gerade hören.“ In dieser Genauigkeit, die Freud als „liebevollste Versenkung“ benennt, entstehe dann die besondere Art der analytischen bzw. psychotherapeutischen Beziehung, die letztendlich Heilung ermögliche.
Download Vortrag Dr. med. Stephan Schmidt (PDF)
Liebe ist mehr als Worte
Kommunikation ist ein wesentlicher Aspekt für das „Gelingen von Liebe“. Das zeigten die verschiedenen Referate an dieser Tagung. Doch die Liebe manifestiert sich auch nonverbal. Dies machten die beiden Musikerinnen Anna Boëthius (Gesang) und Olga Tomilov (Klavier) mit ihren Intermezzi zwischen den Beiträgen erlebbar. Und auch Dr. med. Viktor Meyer näherte sich auf besondere Weise einigen Facetten der Liebe anhand von verschiedenen Liedtexten. Bei Mozart oder Mercedes Sosa, bei Georges Moustaki wie bei Frank Sinatra: Meyer zeigte auf, dass sich der dauernde Prozess der Liebe oft jenseits der Worte in Handlungen und emotionalen sowie körperlichen Erfahrungen abspielt.
Die Tagung in der Klinik Schützen Rheinfelden brachte viele Ansichten, Meinungen, persönliche Praxiserfahrung der verschiedenen Spezialisten sowie konkretes Wissen aus der aktuellen Forschung. Aber trotzdem blieb die Liebe auch nach dieser Fachtagung vor allem eines: Eine überwältigende, rätselhafte menschliche Erfahrung.
TV-Beitrag zum Thema